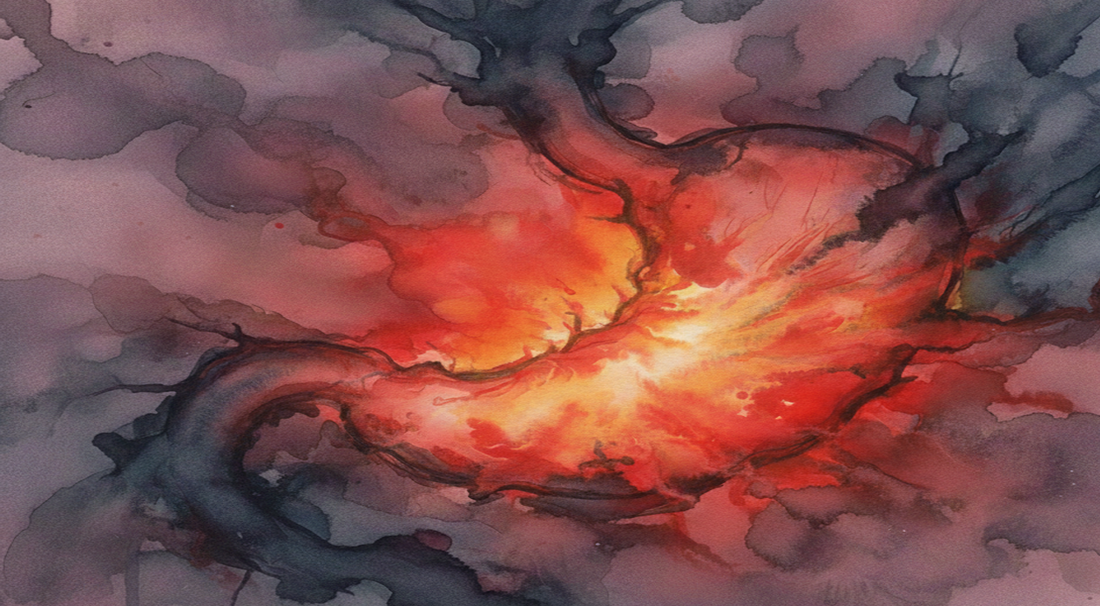
Leitfaden Magen, Darm & Mikrobiom
Vitalpilztherapie bei Gastritis, Ulcus ventriculi & zum Mikrobiomaufbau bei Pferd und Hund
Vorbemerkung:
Magen- und Darmprobleme wie Kotwasser, Durchfall, Magengeschwüre und Ulcera gehören beim Pferd, abgestuft beim Hund, zu den häufigsten Diagnosen. Es sind ernste Erkrankungen, die eine therapeutische Begleitung erfordern.
ABER: An erster Stelle sollte eine Fütterungsoptimierung (v.a. keine Karenzzeiten über 4h beim Pferd i.V.m. Kohlenhydratreduktion) und Haltungsoptimierung (bspw. Stressreduktion) stehen. Diese Themen werden in diesem Artikel nicht vertieft, da dies den Rahmen sprengen würde. Fest steht für mich aber: Therapeutische Maßnahmen sind nur dann überhaupt mit Aussicht auf Erfolg durchführbar, wenn solche Ursachen ebenfalls angegangen werden. Für Pferdebesitzer empfehle ich die Website der Natürlichen Pferdefütterung in diesem Kontext.
Bei einem bereits beeinträchtigten Magen-Darm-Trakt müssen zudem die Dosierung und das Einschleichen unbedingt korrekt berechnet werden. Ich empfehle sogar, bei bereits vorhandenen gesundheitlichen Einschränkungen die Standard Einschleichzeit von 28 Tagen auf 40 oder 60 Tage zu erhöhen.
Ein Dosierungsrechner mit App und in-App-Tagebuch zur Dosierung von Vitalpilzen (Pulver & Extrakt) für Pferde, Hunde und Katzen findet sich auf der Website der Mycelium Pilkraft GmbH: Link.
Weiterführende Informationen zum Einschleichen und zur Anwendung finden sich hier: Link.
Für den schnellen Leser: Vitalpilz-Rezepte als Tabelle mit verlinkten Produkten (meine Empfehlung)
Diese Übersicht dient als schnelle Orientierung, welcher Vitalpilz oder welche Kombination sich für spezifische Indikationen im Kontext von Gastritis und Magengeschwüren bei Pferd und Hund eignet. Sie ersetzt nicht die Lektüre des Hauptartikels, insbesondere der wichtigen Vorbemerkungen zu Fütterung, Haltung und korrekter Dosierung!
|
Indikation / Anwendungsgebiet |
Empfehlung (Pilz/Kombination) |
Wirkung & Hinweise |
|---|---|---|
|
Allgemeine Magen-Darm-Probleme (Gastritis, Geschwüre, Kotwasser, Durchfall, Aufgasung), Basissanierung. |
"Allrounder": Fördert Magenschleimhaut & gute Darmbakterien. Sehr verträglich, ideal als Einstieg. |
|
|
Akute/chronische Schleimhautentzündung (Gastritis, Colitis), geschwächte Darmbarriere ("Leaky Gut"). |
"Entzündungs-Stopp": Hemmt Entzündungen, stärkt die Darmbarriere. Sicherste Wahl bei Magenbeteiligung. |
|
|
Stressbedingte Gastritis (Turnierpferd, Nervosität, Unruhe). |
"Stressbremse": ABM wirkt beruhigend & angstlösend, Pleurotus schützt zusätzlich die Schleimhaut. |
|
|
Akute Schmerzsituation / Kolikneigung / Aufgasung |
"Krampfkolik-Prophylaxe": Pleurotus wirkt krampflösend & beruhigend. ACHTUNG: Bitte Dosis langsam steigern (“einschleichen”) |
|
|
Chronische Darmentzündung (Fokus Dickdarm), Mikrobiom-Stabilisierung. |
"Darm-Spezialist": Stark entzündungshemmend im Darm, stabilisiert Mikrobiom. ACHTUNG: Kann bei akuter Gastritis den Magen reizen. |
|
|
Aufbau nach Antibiose / bei Dysbiose |
Pleurotus ostreatus + Grifola frondosa (Maitake) + Ganoderma lucidum (Reishi) |
"Mikrobiom-Aufbau": Regeneriert die Darmflora und stabilisiert das bakterielle Gleichgewicht. |
|
Magen-Darm-Probleme bei Stoffwechselthemen (EMS, Übergewicht, Insulinresistenz). |
"Stoffwechsel-Harmonie": Unterstützt Stoffwechsel & Gewichtskontrolle, saniert die Verdauung. |
|
|
Verdauungsprobleme bei Allergien oder Immun-Überreaktionen (Asthma, Sommerekzem, Unverträglichkeiten). |
"Allergie-Spezialist": Wirkt antiallergisch (Histamin-Hemmung) und saniert den Darm als Immunzentrum. |
|
|
Leberbeteiligung (sekundär bei Magen-Darm-Problemen) |
Ganoderma lucidum (Reishi) + Agaricus blazei Murill (ABM) + Pleurotus ostreatus |
"Leber-Entlastung": Entgiften und stabilisieren die Leberfunktion, reduzieren Stoffwechsel-Belastungen. |
|
Gezielter Schleimhaut-Aufbau bei nachgewiesenen Magengeschwüren. |
Nur für robuste Tiere: Regeneriert gezielt die Schleimhaut. ACHTUNG: Kann Sinneswahrnehmung steigern, nicht für sensible Tiere geeignet. |
|
|
Magen-Darm-Probleme bei sensiblen Tieren (ängstlich, nervös, schreckhaft). |
"Die sanfte Kur": Sanfter Schutz und Entzündungshemmung ohne die stimulierende Wirkung des Hericium. Sichere Alternative. |
|
|
Langfristige Prophylaxe (nach abgeheilter Gastritis/Ulcus) |
Pleurotus ostreatus (solo oder mit Grifola frondosa (Maitake)) |
"Dauer-Schutz": Sehr verträglich, stärkt dauerhaft Schleimhaut, Darmflora und Stoffwechsel. |
Prävalenz und Bedeutung von Magenerkrankungen bei Pferd & Hund
Grundsätzlich unterscheidet man:
- Gastritis (Magenschleimhautentzündung): Die oberste Schleimhautschicht ist gereizt oder entzündet, was zu Schmerzen, Appetitverlust oder Kolikneigung führen kann.
- Ulcus ventriculi (Magengeschwür): Hier reicht die Schädigung tiefer in die Schleimhaut, teils bis in die Magenwand und Muskulatur des Magens – Funktionsstörungen sind die Folge. Geschwüre entstehen oft aus unbehandelten oder wiederkehrenden Gastritiden.
Beim Pferd fasst man diese Erkrankungen unter dem Begriff Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS = Magengeschwürsyndrom beim Pferd) zusammen. Heute wird zwischen zwei Formen unterschieden:
- ESGD (Equine Squamous Gastric Disease): Schädigung der oberen, nicht-drüsigen Magenschleimhaut (Plattenepithel). Meist durch Magensäure bedingt.
- EGGD (Equine Glandular Gastric Disease): Schädigung der unteren, drüsenhaltigen Magenschleimhaut. Vielschichtige Ursachen, nicht allein säurebedingt.
Woran liegt das und Wie häufig kommt das vor? - Faktenlage!
Wissenschaftliche Forschungen belegen schon lange, dass das Risiko für Magengeschwüre bei Pferden direkt mit deren Ernhährung, Nutzung und dem Stresslevel zusammenhängt.
Das zu lange Karenzzeiten in der Ernährung von Pferden ein Haltungsfehler sind, dürfte hoffentlich jedem Pferdehalter und Stallbetreiber mittlerweile bekannt sein. Die bereits 1996 durchgeführte Studie von Murray & Eichorn belegte das bereits eindeutig, hier traten die ersten Erosionen und Ulzera bereits nach 24 Stunden Futterentzug im Plattenepithel (squamous mucosa) des Magens auf. Nach wiederholtem Entzug im 24-Stunden-Rhythmus über insgesamt 96 Stunden waren die Veränderungen bei allen Pferden deutlich ausgeprägt. Etabliert hat sich nach zahlreichen Folgestudien der Wert von ca. vier Stunden, eine längere, wiederholte Nahrungskarenz ist meiner Meinung nach nicht empfehlenswert, wenn man Pferde verantwortungsvoll halten und Magenprobleme vermeiden möchte.
Was die Nutzung betrifft, fasst das eine aktuelle (2019) Dissertation Stefanie Reimer-Diesbrock ab S. 12f gut zusammen. Am stärksten betroffen sind Rennpferde im aktiven Training, bei denen Läsionen der oberen Schleimhaut (ESGD) mit über 90 % fast die Regel sind, während auch die Drüsenschleimhaut (EGGD) bei bis zu 65 % der Tiere betroffen ist. Eine ähnlich hohe, stark belastungsabhängige Anfälligkeit zeigen Distanzpferde, deren ESGD-Rate im Wettkampf von unter 50 % auf über 90 % ansteigt. Auch bei Sport-, Show- und sogar Freizeitpferden sind Magengeschwüre mit Raten, die oft zwischen 30 % und 60 % für beide Formen liegen, weit verbreitet. Unabhängig von der Nutzung sind zudem rund die Hälfte aller Fohlen betroffen.
Mit Blick auf die Verortung treten ESGD-Läsionen typischerweise an der Grenzzone der Magenschleimhäute (Margo plicatus) auf, während EGGD vornehmlich den Magenausgang (Pylorus) betrifft.
Die Diagnose beim Pferd erfolgt durch eine Gastroskopie (Magenspiegelung mit Kamera), bei der die Schleimhaut untersucht und nach Schweregrad (0–4) eingestuft wird.
Bei Hund & Katze fehlen – anders als bei Pferden – große Prävalenzstudien. Besonders beim Hund spielen Gastritis und Magen-Ulzera im klinischen Alltag aber ebenfalls eine herausgehobene Rolle.
Diagnostisches Mittel der Wahl ist auch hier die Gastroskopie zur 100%igen Abklärung des Krankheitsgeschehens. Ursachen sind unter anderem falsches Futter (Diätfehler), Medikamente (z. B. Schmerzmittel = NSAIDs), Stress oder selten spezielle Bakterien (H.-pylori-ähnliche Organismen).
Welche Vitalpilze sind geeignet?
Im Folgenden werden die aus meiner Sicht wichtigsten Vitalpilze einzeln vorgestellt, die sich in der unterstützenden Therapie von Gastritis und Magenulzera bei Pferd und Hund bewährt haben. Jeder Steckbrief ist nach demselben Schema aufgebaut:
- Kurzbeschreibung mit den wesentlichen Inhaltsstoffen und Effekten
- Wirkungen im Magen-Darm-Trakt mit Bezug zu Schleimhautschutz, Entzündung und Mikrobiom
- Studienlage mit Belegen aus Tier- und Humanmedizin
- Übertragbarkeit auf Hund und Pferd mit Hinweisen aus Praxis und Forschung
- Sicherheit & Besonderheiten mit praktischen Empfehlungen für die Anwendung
So entsteht ein klarer Überblick, wie die einzelnen Pilze spezifisch wirken und welche Rolle sie in einem therapeutischen Gesamtkonzept einnehmen können. Ich habe zusätzlich einige aussagekräftige Studien angefügt, um meine Aussagen zu untermauern, aber den Rahmen dieses Blog Eintrags nicht zu sprengen.
Pleurotus ostreatus (Austernseitling)
Kurzbeschreibung:
Der Austernseitling ist ein Speisepilz mit nachgewiesenen medizinischen Effekten. Er enthält viele β-Glucane (Ballaststoffe mit immunmodulierender Wirkung) und Antioxidantien. Im Verdauungstrakt wirkt er präbiotisch (fördert nützliche Darmbakterien), antioxidativ (fängt freie Radikale ab) und magenprotektiv (schützt die Schleimhaut).
Der Austernpilz ist nicht zuletzt aufgrund seiner Verträglichkeit mein "Remedium cardinale" bei Magen- und Darmproblemen. Kotwasser, Durchfall, Aufgasung, Gastritis, Magengeschwür - diesen Pilz setze ich so gut wie immer ein.
Wichtige Wirkungen im Magen-Darm-Trakt:
- steigert die Bildung von Magenschleim (Mucinschicht) und schützt so vor Säure
- unterstützt die Abheilung von Magengeschwüren
- moduliert das Mikrobiom zugunsten nützlicher Bakterien
- hemmt in Laborversuchen das Wachstum von Helicobacter pylori
Ausgewählte Studien:
- Yang et al. (2012): In einem Rattenmodell hemmte ein wasserlösliches Polysaccharid (POPw) aus Pleurotus die Entwicklung von Magengeschwüren deutlich. Es erhöhte Magenschleim (Mucin), schützende Prostaglandine (Botenstoffe) und antioxidative Enzyme (z. B. Glutathion, SOD), während oxidativer Stress abnahm. Quelle: PubMed – "Gastroprotective activities of a polysaccharide from the fruiting bodies of Pleurotus ostreatus in rats"
- Hu et al. (2022): Bei adipösen Mäusen verbesserte Pleurotus die Darmflora: mehr Lactobacillus, Bifidobacterium und Oscillospira, weniger schädliche Keime. Gleichzeitig stieg die Bildung kurzkettiger Fettsäuren (wichtige Schutzstoffe für den Darm). Quelle: MDPI – "Pleurotus ostreatus ameliorates obesity by modulating the gut microbiota in obese mice"
- Schweinemodell: Bei Ferkeln erhöhte P. ostreatus die Vielfalt der Darmflora und die Bildung kurzkettiger Fettsäuren – ein Hinweis auf mögliche Übertragbarkeit auf Hund und Pferd. Quelle: "Effects of pulverized oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) on diarrhea incidence, growth performance, immunity, and microbial composition in piglets"
Übertragbarkeit auf Hund und Pferd:
- als Vitalpilz grundsätzlich sehr verträglich
- präbiotische Effekte wie beim Menschen (Fütterung von „guten“ Bakterien)
- für Pferde gibt es Studien bisher nur im Reagenzglas, aber es gibt hervorragende Erfahrungswerte aus dem klinischen Alltag
Sicherheit & Besonderheiten:
- sehr sicher, keine bekannten Kontraindikationen, selbst bei bestehenden Magenproblemen
- Aber: hoher Ballaststoffgehalt kann in großen Mengen oder bei zu schneller Steigerung der Dosis leicht abführend wirken
- stärkt zusätzlich das Bindegewebe, stützt die Leber bei der Entgiftung, wirkt extrem stark antioxidativ und ist mein Geheimtipp für Muskelaufbau & Training, Fell & Hufe.
Grifola frondosa (Maitake)
Kurzbeschreibung:
Maitake (Klapperschwamm) ist ein Heil- und Speisepilz, der vor allem für seine immunmodulierenden und metabolischen Effekte bekannt ist. Seine β-Glucan-Fraktionen (z. B. die sogenannte D-Fraction) zeigen in Studien antitumorale Wirkungen und eine Aktivierung des Immunsystems. Maitake kann den Blutzuckerspiegel positiv beeinflussen (Insulinsensitivität erhöhen) und besitzt antioxidative Eigenschaften.
Im Kontext des Gastrointestinaltrakts setze ich Maitake bei Magen-Darm-Beschwerden und Stoffwechselproblemen ein, insbesondere zur Regulierung des Mikrobioms (zusammen mit Austernpilz/Pleurotus). Neuere Untersuchungen konzentrieren sich vor allem auf diese entzündungshemmenden Effekte im Darm und die präbiotischen Wirkungen von Maitake - etwas was die klinische Praxis meiner Meinung nach bereits deutlich anzeigt.
Wichtige Wirkungen im Magen-Darm-Trakt:
- entzündungshemmend durch Hemmung proinflammatorischer Zellbotenstoffe
- schützend auf die Schleimhaut durch Stärkung der Darmbarriere (Tight Junctions)
- antioxidativ und regulierend auf den oxidativen Stress
- präbiotische Wirkung über Fermentation im Dickdarm, was besonders beim Pferd wichtig ist
Ausgewählte Studien:
-
Park et al. (2010): Ein Maitake-Wasserextrakt (GFW) hemmte in Zellkultur die durch TNF-α ausgelöste Entzündungsreaktion und verringerte die Expression von Chemokinen (MCP-1, IL-8). In Immunzellen wurde die TNF-α-Produktion selbst unterdrückt (über NF-κB-Hemmung). In einem Rattenmodell der Kolitis (TNBS-induziert) reduzierte GFW Gewichtsverlust, Ulzera und Entzündungsmarker. Die Wirkung war vergleichbar mit Mesalazin (5-ASA).
Quelle: “Grifola frondosa water extract alleviates intestinal inflammation by suppressing TNF-α production and its signaling”. -
Chen et al. (2025): Antioxidative Peptide aus Maitake verbesserten in einem Mausmodell der Colitis ulcerosa (DSS-induziert) Symptome wie Durchfall und Gewichtsverlust. Histologisch war die Schleimhautentzündung deutlich reduziert. GFAP senkten die Spiegel von TNF-α, IL-1β und IL-6, stärkten die Barriereproteine (Occludin, ZO-1) und dämpften TLR4/iNOS. Gleichzeitig wurde das Mikrobiom günstig moduliert: weniger Proteobacteria, mehr Bacteroidetes und Firmicutes (u. a. Bacteroides uniformis, Alistipes).
Quelle: PubMed – “Protective Effect and Gut Microbiota Modulation of Grifola frondosa Antioxidant Peptides in DSS-Induced Ulcerative Colitis Mice”
Übertragbarkeit auf Hund und Pferd:
- Achtung: Noch fehlen spezifische GI-Studien an Hund oder Pferd, so dass vor allem hinsichtlich Aussagen über die Entwicklung des Mikrobioms Zurückhaltung angezeigt ist, weil Daten über Mehrheitsverhältnisse von Bakterienstämme nicht ohne weiteres zwischen Tierarten übertragbar sind
- immunmodulatorische Effekte von Maitake sind potenziell aber bei allen entzündlichen Darmerkrankungen von Nutzen
-
wird in der Tiermedizin bereits vereinzelt eingesetzt (v. a. Metastasenverhütung in der Onkologie)
- Unabhängig von spezifischer, detaillierter Mikrobiologie legen Erfahrungen aus der klinischen Praxis nahe, dass Maitake eine hervorragende Wirkung auf den Stoffwechsel (EMS & Gewichtsmanagement!) über die positive Beeinflussung der Verdauung hat
Sicherheit & Besonderheiten:
- Wirkt blutzuckersenkend wirken → Vorsicht bei Diabetikern (Kontrolle der Medikation erforderlich, Dosierung prüfen)
- insgesamt in Studien (inkl. Phase-I) keine wesentlichen Nebenwirkungen dokumentiert
- Kurbelt den Stoffwechsel an, hilft bei der Gewichtskontrolle und ist bei EMS bzw. bei der Prophylaxe EMS-bedingter Hufrehe der zentrale Pilz
Ganoderma lucidum (Reishi, Ling Zhi)
Kurzbeschreibung:
Ganoderma lucidum, der Glänzende Lackporling, ist einer der am umfassendsten erforschten Heilpilze. In der traditionellen ostasiatischen Medizin wird Reishi seit Jahrhunderten als Tonikum für Langlebigkeit und Vitalität geschätzt ("Pilz der Unsterblichkeit").
Biochemisch zeichnet er sich durch eine Vielfalt an Polysacchariden (β-Glucane) und Triterpenen (Ganodersäuren) aus. Reishi wirkt stark immunmodulierend – er kann das Immunsystem zugleich stimulieren (z. B. Aktivierung von Makrophagen, NK-Zellen) und im Falle von Überreaktionen dämpfen (anti-inflammatorische Zytokinprofile). Darüber hinaus sind antioxidative, antitumorale, leberschützende und antimikrobielle Effekte dokumentiert.
Im gastrointestinalen Kontext zeigen Reishi-Extrakte sowohl protektive Effekte auf die Magenschleimhaut (Schutz vor Ulzera, Förderung der Schleimproduktion) als auch entzündungshemmende Wirkungen im Darm (etwa in Colitis-Modellen). Zudem deuten Studien an, dass Reishi die Darmflora positiv beeinflusst – seine Polysaccharide dienen als Präbiotika für kurzkettige Fettsäure-bildende Bakterien (wie bspw. Butyrat) und können pathogene Keime unterdrücken. Insgesamt kann Ganoderma so zur Mikrobiom-Stabilisierung, Schleimhautregeneration und Immunbalance im GI-Trakt beitragen.
Wichtige Wirkungen im Magen-Darm-Trakt:
-
starkt entzündungshemmend im Darm, z. B. in Colitis-Modellen (bitte bei Magenproblemen meinen u.a. Hinweis zur Sicherheit beachten!)
-
präbiotische Effekte durch Polysaccharide
- antimikrobiell, u. a. gegen Helicobacter pylori
Ausgewählte Studien:
-
Gao et al. (2002): Reishi-Polysaccharide beschleunigten im Rattenmodell (Indometacin-induzierte Ulzera) die Abheilung von Magenläsionen. Die Schleimproduktion und Prostaglandin E2 (PGE₂) in der Magenschleimhaut nahmen zu. Zusätzlich normalisierte Reishi die Expression von Wachstums- und Gefäßfaktoren (EGF, bFGF, VEGF, NO) nach Ulkusverletzungen.
Quelle: PMC – "Mechanism of the antiulcerogenic effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on indomethacin-induced lesions in the rat"
-
Xie et al. (2019): In einem Colitis-Modell (DSS-induzierte Colitis in Ratten) senkten Reishi-Polysaccharide den Disease Activity Index signifikant. Begleitend erhöhte sich die Produktion kurzkettiger Fettsäuren, SCFA-produzierende Bakterien (z. B. Ruminococcus) nahmen zu, pathogene Keime wie Escherichia/Shigella ab. Zudem regulierte Reishi die Genexpression in Darmepithelzellen: 11 Gene mit Bezug zu Tight Junctions und Entzündung wurden schützend beeinflusst.
Quelle: PubMed – "Ganoderma lucidum polysaccharide improves rat DSS-induced colitis by altering cecal microbiota and gene expression of colonic epithelial cells" -
Antimikrobielle Effekte: Breite Übersichtsstudie zur Wirkung von Medizinalpilzen bei Infektionen mit Helicobakter pylori. Unter anderem auch Ethanol-Extrakte aus Reishi hemmten in vitro effektiv das Wachstum von Helicobacter pylori (MHK <3 mg/ml).
Quelle: PMC – "In vitro anti-Helicobacter pylori effects of medicinal mushroom extracts, with special emphasis on the Lion's Mane mushroom, Hericium erinaceus (higher Basidiomycetes)"
Übertragbarkeit auf Hund und Pferd:
-
in der Veterinärmedizin bei Hunden und Pferden verbreitet, v. a. zur Immununterstützung (z. B. bei Asthma, Allergien, Infektionen)
-
Hinweise auf positive Effekte auf die Darmgesundheit vorhanden
-
bei Katzen in Erfahrungsberichten gut verträglich, ABER: bitte korrekt dosieren und vorsichtig therapieren (kurweise!): Reishi enthält viele Phenolverbindungen, die die Katze nur schwer metabolisieren kann.
Sicherheit & Besonderheiten:
- Vorsicht bei Antikoagulation: Reishi wirkt leicht blutverdünnend, therapeutische Begleitung empfohlen
- Mögliche Nebenwirkungen: Die enthaltenen Ganodermsäuren können in Einzelfällen die Magenschleimhaut zusätzlich reizen - bei Gastritis und/oder Magengeschwüren wäre meine erste Empfehlung daher immer Austernpilz (Pleurotus) zusammen mit Maitake.
-
insgesamt sehr sicheres Profil, millionenfacher Einsatz in Humanmedizin, gute Erfahrungen auch in Tiermedizin
Agaricus blazei Murill (ABM)
Kurzbeschreibung:
Agaricus blazei Murill – auch „Mandelpilz” oder in Brasilien „Sonnenpilz” genannt – ist ein Champignon-Verwandter mit hohem Gehalt an immunaktiven Polysacchariden. ABM wird in Japan und anderen Ländern als medizinischer Speisepilz kultiviert und in Asien u.a. in der Krebstherapie als Standard unterstützend eingesetzt. Seine Effekte umfassen starke Immunmodulation sowie entzündungshemmende Wirkungen durch Modulation von Zellbotenstoffen, vor allem bei Allergien (z.B. verringerte Histaminfreisetzung).
Im gastrointestinalen Kontext ist ABM interessant, weil er autoimmune Darmentzündungen lindern, die Schleimhautbarriere stabilisieren und das Mikrobiom positiv beeinflussen kann (präbiotische Wirkung durch β-Glucane).
Wichtige Wirkungen im Magen-Darm-Trakt:
- Immunmodulation auf Zellebene
- entzündungshemmend (Zytokinmodulation, antioxidativ)
- stärkt die Schleimhautbarriere (Tight Junctions, Schleimproduktion)
- präbiotisch
- antiallergisch (v.a. Histaminhemmung)
Ausgewählte Studien:
-
Therkelsen et al. (2016): Klinische Studie mit 50 Colitis-ulcerosa-Patienten (AndoSan™, Füssigextrakt-Kombination aus ABM, aber auch Maitake & Hericium). Nach 3 Wochen sank der Symptom-Score signifikant (5,88 → 4,50; p=0,001). Verbesserungen betrafen Bauchschmerzen, Stuhlfrequenz, Fatigue und Lebensqualität. Keine Nebenwirkungen berichtet.
Quelle: PLOS ONE – "Effect of a medicinal Agaricus blazei Murill-based mushroom extract (AndoSan™) on symptoms, fatigue and quality of life in patients with ulcerative colitis" -
Ji et al. (2023): In einem Mausmodell reduzierte ein gereinigtes ABM-Polysaccharid den Krankheits-Score, minderte Gewebeschäden, stärkte die Tight Junctions (ZO-1, Occludin), erhöhte die Schleimproduktion und senkte proinflammatorische Zytokine. Hinweise auf vermehrte Bildung kurzkettiger Fettsäuren.
Quelle: MDPI – "Agaricus blazei Polysaccharide alleviates DSS-induced colitis in mice by modulating intestinal barrier and remodeling metabolism"
Übertragbarkeit auf Hund und Pferd:
- Hund: in mehreren (v.a. onkologischen) Studien getestet, gut verträglich, keine toxischen Effekte
-
Tierstudien und Praxis belegen für Allergiepatienten (v.a. Pferd, insb. Asthma und Sommerekzempatienten) eine hervorragende Wirkung Verträglichkeit.
Sicherheit & Besonderheiten:
-
gilt allgemein als sicher, auch bei längerer Einnahme
- Wirkt zusätzlich stark antiallergisch (Asthma, Ekzem)
- ausgeprägte antioxidative und zellschützende Wirkungen auf die Zellmembran von Leberzellen (ähnlich wie Mariendistel)
Hericium erinaceus (Igelstachelbart, Löwenmähne)
Kurzbeschreibung:
Hericium erinaceus, bekannt als Löwenmähne oder Igelstachelbart, ist ein bemerkenswerter Heilpilz mit breitem Wirkspektrum. Besonders bekannt ist seine neurotrophe Wirkung: Inhaltsstoffe wie Hericenone und Erinacine fördern den Nervenwachstumsfaktor (NGF) und unterstützen dadurch Nervenregeneration und kognitive Funktionen, bspw. bei Demenzerkrankungen. Darüber hinaus wirkt Hericium entzündungshemmend und antioxidativ.
In der Traditionellen Chinesischen Medizin wird er seit Jahrhunderten auch bei Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt, insbesondere bei chronischer Gastritis, Magengeschwüren und zur Stärkung der Verdauung. Moderne Forschung bestätigt diese Anwendungsgebiete: gastroprotektive Effekte, anti-Helicobacter pylori-Wirkung, Förderung der Schleimhautregeneration und Modulation der Darmflora.
CAVE: Hericium ist mit Abstand der am häufigsten eingesetzte Vitalpilz bei Verdauungsproblemen beim Tier, es gibt bereits zahlreiche Produkte. Oft sind das Kombiprodukte von Tierfutterherstellern, die "Magenschonung" oder ähnliches propagieren, in den wenigsten Fällen ist Hericium deklariert. Ich führe diese Pilz nicht ohne grund zuletzt in dieser Liste an. Bei mir häufen sich die Rückmeldungen verunsicherter Tierbesitzer, der Tiere nach der Verabreichung von Hericisum ängstlich, hypersensitiv oder hysterisch reagieren. Vor allem bei Pferden, die höher im Blut stehen, ist Vorsicht geboten. Die neurotrophe Wirkung (NGF-Stimulation) gilt meist als positiv; weil so die Unterstützung der neuronalen Gesundheit und der kognitiven Funktion erreicht werden kann Erhöht die Sinneswahrnehmung (Gehör & Geruch, bitte Umsicht bei schreckhaften Tieren (z.B. Fluchttiere wie Pferde, ängstliche Hunde & Katzen, Sylvester usw.)
Wichtige Wirkungen im Magen-Darm-Trakt:
- Schutz der Magenschleimhaut (verstärkte Schleimproduktion, antioxidativer Schutz)
-
antibakteriell gegen Helicobacter pylori
-
entzündungshemmend (Reduktion proinflammatorischer Marker, Stabilisierung von Zellmembranen)
- präbiotisch
Ausgewählte Studien:
-
Wong et al. (2013): In einem Rattenmodell (Ethanol-induzierte Ulzera) reduzierte ein wässriger Hericium-Extrakt die Größe und Anzahl der Ulzera signifikant. Mechanismen: erhöhte Mucinbildung (gemessen per Alcianblau-Test), gesteigerte antioxidative Enzyme (SOD, Katalase), verminderter oxidativer Stress und Schutz vor Apoptose.
Quelle: PMC – "Gastroprotective effects of Lion’s Mane Mushroom (Hericium erinaceus) extract against ethanol-induced ulcer in rats" -
Abbas et al. (2019): Laborstudie: Extrakt-Fraktionen hemmten H. pylori in vitro, inklusive Urease-Inhibition. Zudem hohe antioxidative Aktivität. Ähnliche Ergebnisse wurden für Polysaccharid-Extrakte berichtet.
Quelle: Biomed Research and Therapy – "Antioxidant and anti-Helicobacter pylori activities of Hericium erinaceus" -
Kim et al. (2022): Fütterungsstudie an 18 älteren Hunden: 16 Wochen Hericium-Futter (0,4–0,8 g/kg) führten zu positiver Mikrobiota-Verschiebung. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Aufnahme einer höheren Dosis des Pilzes die Zusammensetzung der Darmmikrobiota reguliert, was sich durch eine signifikante Veränderung der Firmicutes/Bacteroidetes (F/B)-Ratio zeigte. Diese Regulierung könnte möglicherweise die Immunität und Adipositas-Prävention bei älteren Hunden verbessern.
Quelle: PMC – "Gut microbiota profiling in aged dogs after feeding pet food containing Hericium erinaceus"
Übertragbarkeit auf Hund und Pferd:
-
Hund: Studien belegen Wirksamkeit und Verträglichkeit bei der Mikrobiomsanierung; bereits in zahlr Nahrungsergänzungen enthalten; Einsatz zur Unterstützung der Darmgesundheit besonders bei älteren Tieren oder Dysbiose
- Pferd: Zahlreiche positive Erfahrungswerte, aber bitte vorsichtige Einführung (schrittweise, kleine Dosen) und den folgenden Hinweis beachten
Sicherheit & Besonderheiten:
- CAVE: Hericium ist der am häufigsten eingesetzte Vitalpilz bei Verdauungsproblemen von Tieren. Entsprechend gibt es zahlreiche Produkte, oft in Form von Kombipräparaten zur „Magenschonung“. In den wenigsten Fällen ist Hericium dabei jedoch korrekt deklariert.
- Ich führe diesen Pilz bewusst zuletzt in dieser Liste auf. Hintergrund sind vermehrte Rückmeldungen von Tierbesitzern in meiner klinischen Praxis, deren Tiere nach Gabe von Hericium ängstlich, hypersensitiv oder hysterisch reagierten. Besonders bei Pferden, die „hoch im Blut stehen“, ist Vorsicht geboten.
- Für die primäre Indikation „Magen/Darm“ ist Hericium bewährt. Die neurotrophe Wirkung von Hericium – insbesondere die Förderung des Nervenwachstumsfaktors (NGF) – ist ebenfalls erwiesen und gilt grundsätzlich als positiv, da sie neuronale Gesundheit und kognitive Funktionen unterstützt.
- Gleichzeitig kann sie jedoch die Sinneswahrnehmung (z. B. Gehör, Geruch) verstärken. Das erfordert Umsicht bei schreckhaften Tieren (Fluchttiere wie Pferde, ängstliche Hunde und Katzen, Jahreswechsel/Silvester).
- Solche unerwünschten Wirkungen treten häufig dosisabhängig auf. Ein langsames Einschleichen ist daher dringend zu empfehlen.
- Die erhöhte Sinneswahrnehmung ist so gut wie immer reversibel und verschwindet mit dem Absetzen des Vitalpilzes erfahrungsgemäß nach ca. ein-zwei Wochen.
- Bei Tieren mit ausgeprägter Sensitivität kann auf alternative Vitalpilze zurückgegriffen werden, die den Verdauungstrakt sanft unterstützen, etwa Pleurotus und/oder Maitake.

